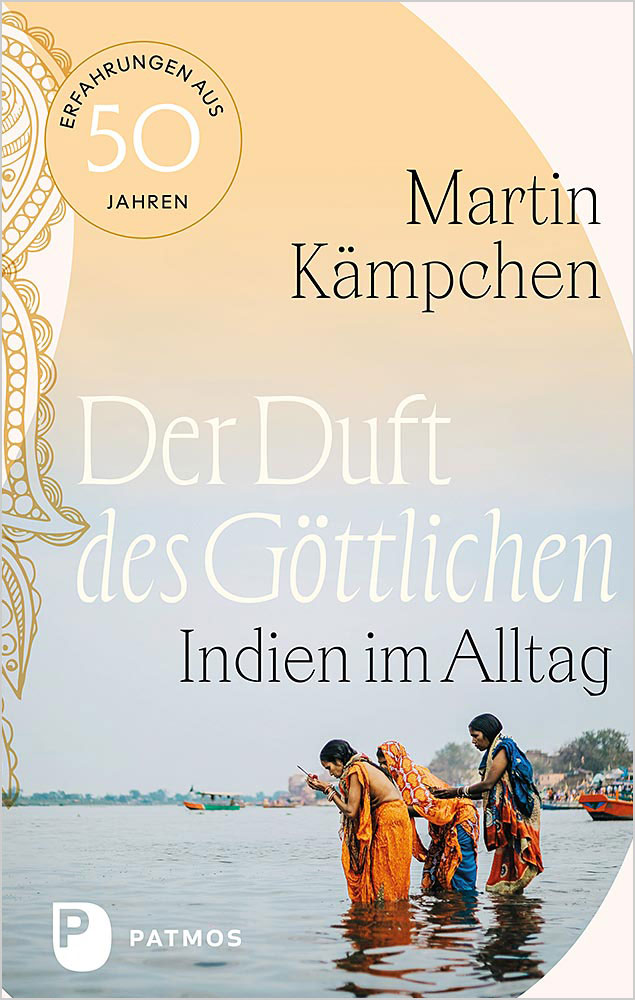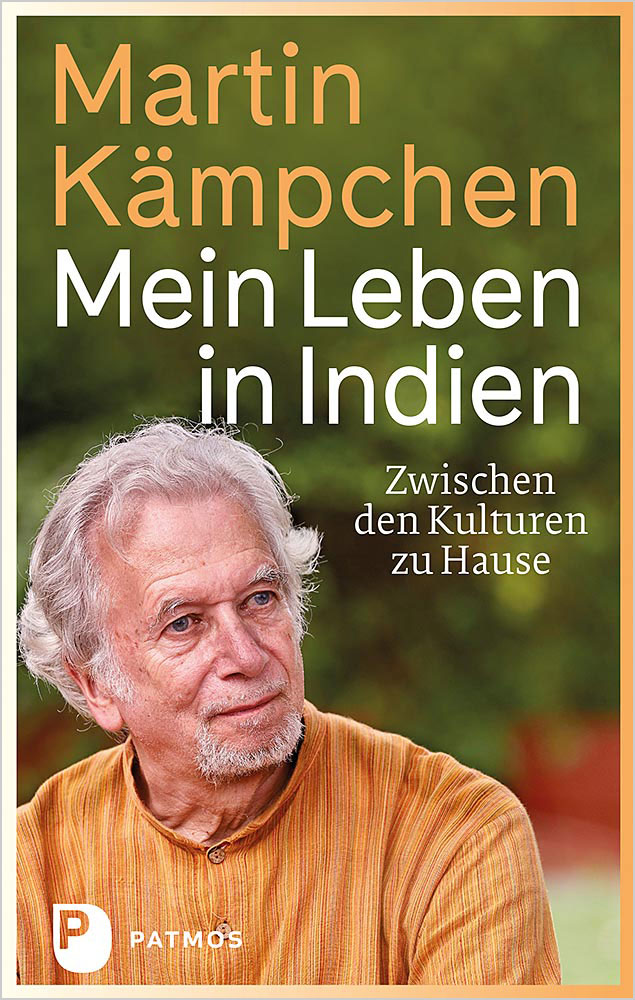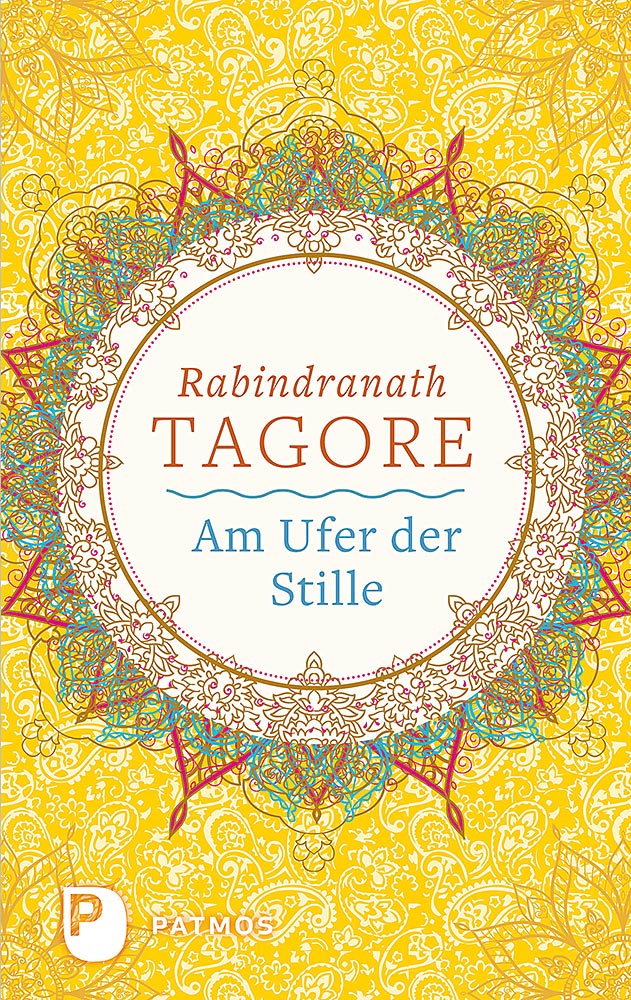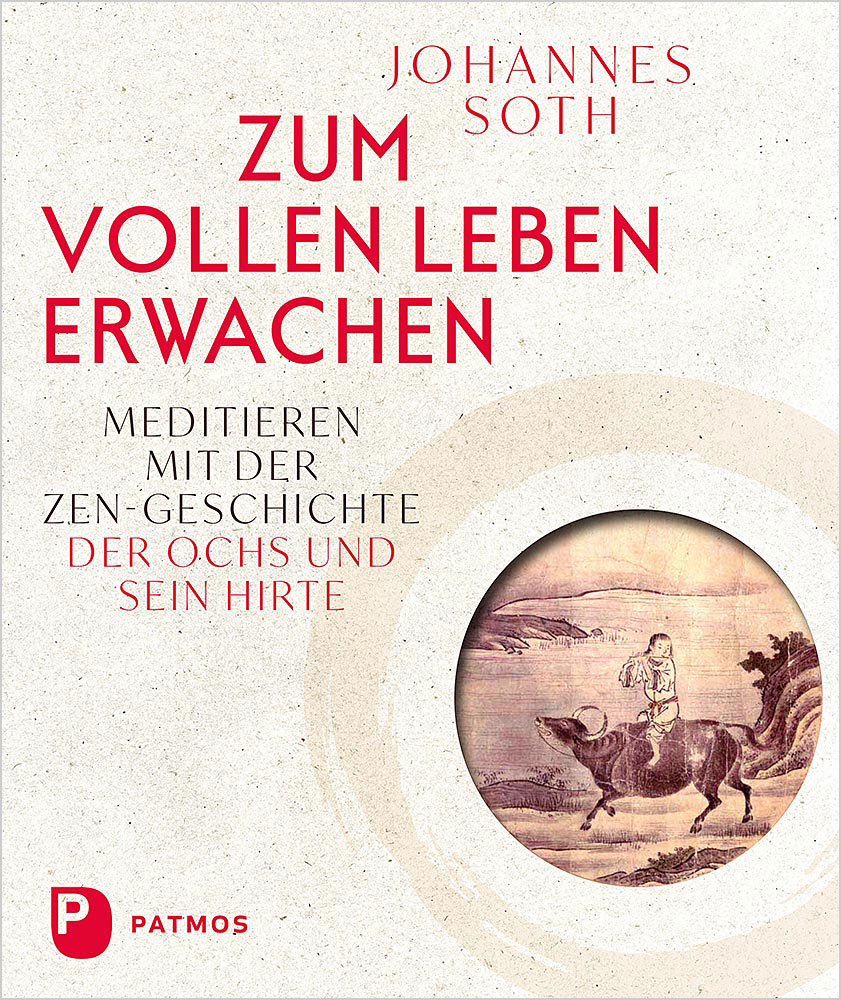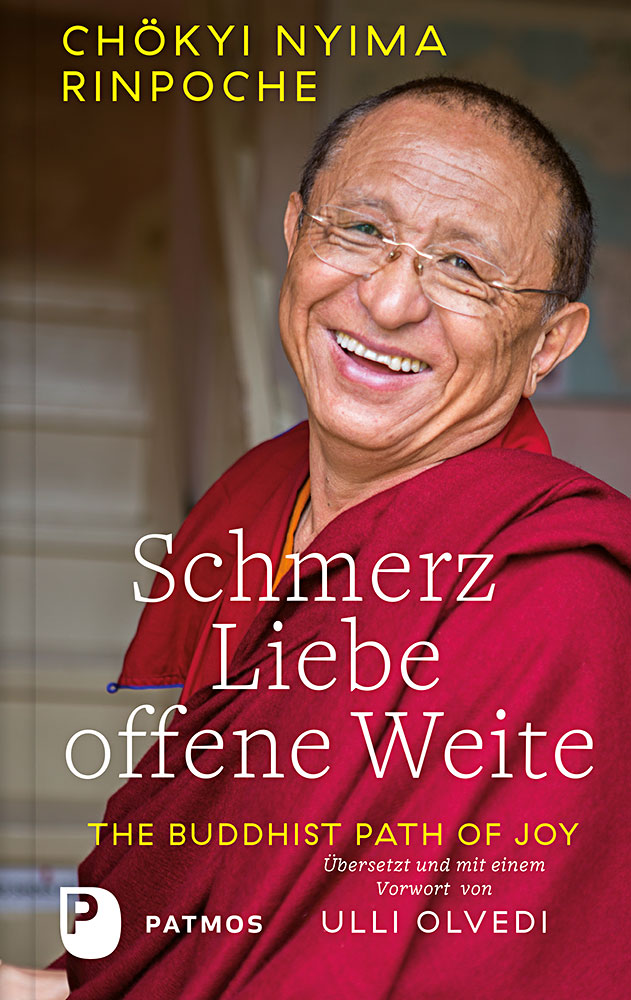50 Jahre Fernsehen in Indien
Martin Kämpchen lässt uns an seinem reichen Erfahrungsschatz, den er über 50 Jahre in Indien gesammelt hat, teilhaben und erzählt, wie das Fernsehen nach und nach die indischen Wohnzimmer erobert hat.
Reportage Gesellschaft»Vom Fernsehen« ... Inder sind ein bilderhungriges, ein schaulustiges Volk. Es begeistert sie, die Welt mit den Augen in sich aufzunehmen. Man stelle sich an den Straßenrand eines Dorfes oder einer kleinen Stadt und schaue unverwandt nach oben. Es wird nur einige Minuten dauern, bis sich Menschen allen Alters danebenstellen und den Himmel absuchen, was es denn zu schauen gebe. Augengenuss ist kostenlos, und Indien hat mit seinem bunten, lebendigen Treiben den Augen stets übergenug zu bieten. Gäste aus Europa fühlen sich oft überwältigt von so viel Augenschmaus. Die übrigen Sinneseindrücke – der Lärm oder die Lieder, die kräftigen Gerüche und der Geschmack von scharf gewürzten Speisen – sind ebenso ungewohnt durchdringend, jedoch ist die Schau der vielfältigen Welt das erschütterndste Erlebnis, weil nichts Beschönigendes, Besänftigendes, Entschuldigendes zwischen die Sinne und die Realität tritt. Die visuelle Welt präsentiert sich den Augen knallhart.
Als im Jahr 1959 das Fernsehen in Indien einzog, war es zunächst das Privileg der Elite, einen Apparat zu besitzen. Doordarshan, das staatliche Fernsehen, strahlte jahrelang nur ein Programm in New Delhi, der Hauptstadt, aus; später zogen die anderen Metropolen nach. Es dauerte über zwei Jahrzehnte, genauer: bis 1982, bis Fernsehen landesweit verbreitet war. Im selben Jahr schaltete man von Schwarzweiß auf Farbe um. Anfang der 1990er-Jahre kamen private Kanäle hinzu.
Zu Beginn war der Fernsehapparat ein Ort, vor dem man sich zu bestimmten Zeiten versammelte, um Sendungen schweigend anzuschauen. Als die großen mythologischen Serials ausgestrahlt wurden, etwa das Rāmāyana und das Mahābhārata, war das Zuschauen wie ein Gottesdienst. Jeden Sonntagmittag kam die Familie zusammen. Die Hausfrau stellte sogar eine Öllampe auf den Apparat und entzündete Räucherstäbchen.
Diese Serials zogen sich über Monate hin. Die Handlung war breit ausgefächert, die bombastische Musik und die unendlichen Variationen derselben Szenen schienen das Pathos des Epos atmosphärisch zu evozieren. Europäer wären gelangweilt, denn sie wollen Handlung, Action. Aber das indische Publikum wollte heilige, symbolstarke Bilder und Bildersequenzen. Dass sie immer wiederholt wurden – wie bei einer Litanei –, förderte eine Steigerung der religiösen Gefühlsintensität.
Fernsehen gefährdet das indische Familienleben
Heute hat jede Hütte einen solchen Wunderkasten. Sogar in der Ein-Zimmer-Slum-Wohnung, mit Wellblech bedeckt und fensterlos, steht er; oder, um Platz zu sparen, baumelt er an der niederen Decke. Besitzt die Wohnung keine Stromleitung, no problem: Der Apparat funktioniert auch mit Batterien.
Das Fernsehen ist in den armen wie mittelständischen Haushalten so allgegenwärtig geworden, dass es den Zusammenhalt der Familien gefährdet. Wenn tagsüber wahllos die Programme laufen, sind Gespräche, ist gesammeltes Lesen oder Arbeiten kaum möglich. Schülerinnen und Schüler, die nicht ihr eigenes Zimmer zum Lernen haben, werden immerzu von dem Bildschirm angezogen sein. Die Atmosphäre wird diffus, weil kaum jemand eine Sendung aufmerksam verfolgt. Das Fernsehen ist wenig mehr als eine bewegte Zimmertapete.
Fernsehen als Kanal zur Bevölkerung
Blicken wir auf die Vielzahl der Programme heute, ist der staatliche Kanal Doordarshan, mit dem Fernsehen in Indien begann, an Popularität weit abgeschlagen. Es gibt rund 900 von Satelliten verbreitete Privatkanäle. Sie liefern sich einen heftigen Kampf um die Vorherrschaft bei den Zuschauerzahlen. Gemessen an der Diversität des Landes und den daraus folgenden vielfältigen Sonderinteressen und Themen, verwundert diese Zahl nicht. Jede der 24 offiziellen Sprachen beansprucht mehrere Kanäle; große Industriehäuser und Zeitungen betreiben ihre Kanäle; bekannte spirituelle Gurus verbreiten ihre Botschaften in eigenen Kanälen.
Wenn ich, wie es manchmal geschieht, abends allein in einem indischen Hotelzimmer sitze und die Fernsehkanäle durchklicke, um einen Eindruck von Inhalt und Vielfalt zu erhalten, muss ich jedes Mal über die schrille Farbigkeit, die Sentimentalität und die oft plakative Lebhaftigkeit der Programme staunen. Talkshows sind heftig ausgefochtene Kämpfe um die Dominanz der eigenen Meinung. Da solche Talkshows immer auch politisch sind, geht es stets auch um eine Machtdemonstration bestimmter Parteien oder Richtungen.
Die Nachrichtensendungen irritieren mich, weil den Zuschauern zugemutet wird, dem Sprecher oder der Sprecherin zuzuhören, aber gleichzeitig mehrere Sprachbänder, aufblinkende »Breaking News« und Werbespots aufzunehmen und einzuordnen. Es ist vermutlich den amerikanischen Fernsehnachrichten abgeschaut und verleitet, ebenso wie jene, zu hektischer, verwirrender Oberflächlichkeit.
Unter der armen Bevölkerung wird der traditionelle Fernsehapparat allerdings nach und nach vom Smartphone vertrieben. Den Familien genügt es durchaus, ihre Fernsehunterhaltung über das kleine Bild ihrer Mobiltelefone zu bekommen.
Martin Kämpchen, aus »Der Duft des Göttlichen – Indien im Alltag. Erfahrungen aus 50 Jahren«, Kapitel »Vom Fernsehen«
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Abonnieren Sie hier unseren Newsletter und erhalten Sie jede Woche weitere interessante Impulse, Geschichten und Rezepte.