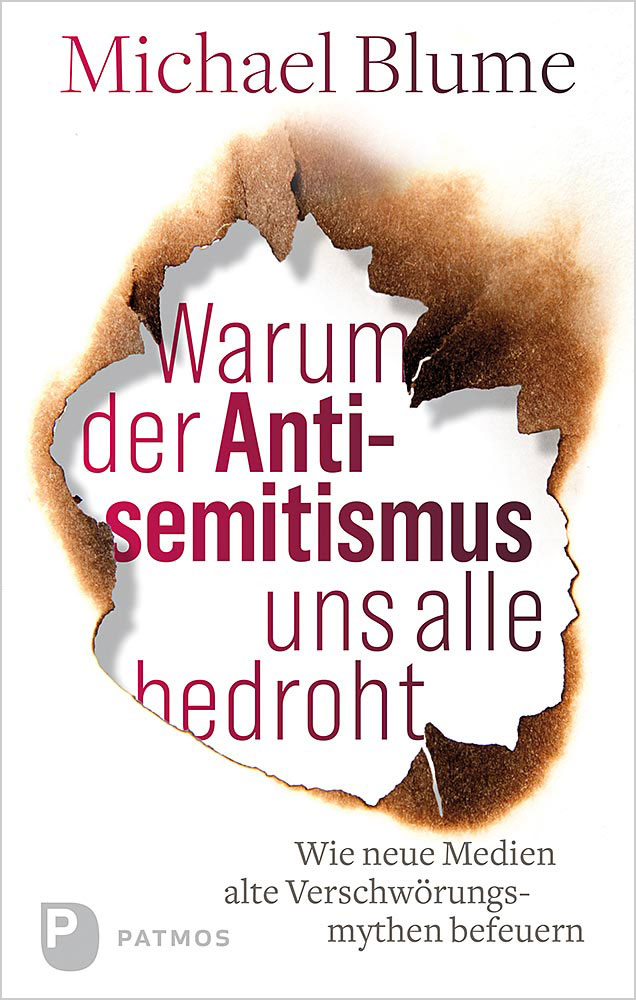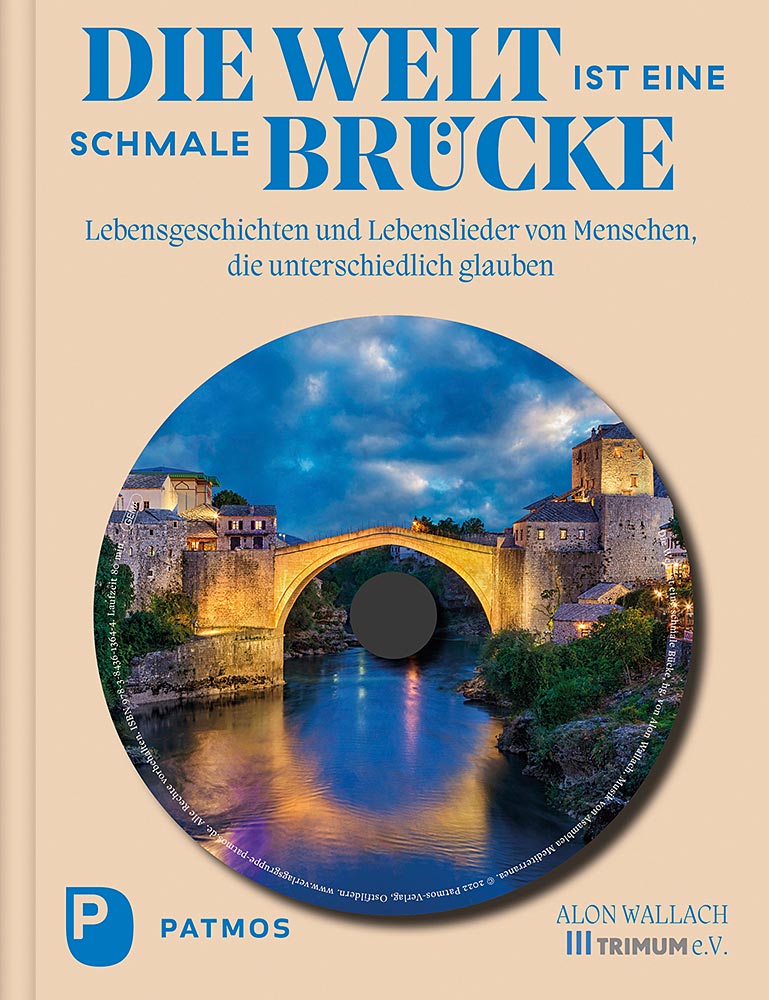»Dieses Gefühl, nicht ganz dazuzugehören«
Sarah Vecera über »Migrationshintergründe« und Rassismus im Alltag aus ihrem Buch »Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus«.
Ein Beitrag zur »Interkulturellen Woche 2023«
Lange Zeit habe ich mich damit zufrieden gegeben, dass Leute mir den Stempel »Migrationshintergrund« aufdrückten. In der Jugendarbeit wurde ich häufig damit betitelt, es sollte zeigen, wie international und bunt wir waren. Damit jede:r sieht: Hier ist jede:r willkommen, und wir sind alle gleich! Das Wort Migrationshintergrund wurde im Zusammenhang mit mir zwar vermeintlich positiv benutzt, gleichzeitig wirkt der Begriff in unserer Gesellschaft aber wie eine Diagnose: Der ist unpünktlich, die macht ihre Aufgaben nicht, der ist schlampig,... »Ja klar, die haben ja auch Migrationshintergrund.« – »So ist das bei denen halt.« – »Das haben die im Blut.« Da haben wir sie, die Anspielung auf die Erfindung der Menschenrassen, die dieses und jenes »im Blut haben« – hier wird dieser schädliche Glaube mit dem Euphemismus »Migrationshintergrund« bezeichnet.
Wann wir von »Kulturrassismus« reden
Es ist eine einfache Erklärung geworden, um Verhaltensweisen zu begründen, ohne sich mit der dahinterstehenden Problematik auseinandersetzen zu müssen. Heute weiß ich, dass man Synonyme wie »Migrationshintergrund« oder »Kultur« verwendet, um Menschen zu rassifizieren, ohne den Begriff der »Rasse« zu verwenden. Man spricht auch von »Kulturrassismus«: Dabei geht man davon aus, dass Migration oder Kultur unüberwindbare Hürden seien, und verschleiert dadurch die längst widerlegte Rassenideologie nur durch neue Begriffe. Die dahinter liegende Vorstellung des Konstrukts »Rasse«, dass es unüberwindbare Unterschiede zwischen weißen und schwarzen Menschen gäbe, bleibt dabei also bestehen.
»Was aber zum ›richtigen‹ Deutsch-Sein fehlt: Ich bin nicht weiß.«
Ich wusste schon lange, dass mich die Bezeichnung »mit Migrationshintergrund«, auf mich bezogen, störte. Mir war sie unangenehm, aber ich habe es jahrelang über mich ergehen lassen, so von Leuten bezeichnet zu werden, die es nur gut meinten, die es für was Besonderes hielten. Daher habe ich mich nicht getraut, mein Unbehagen anzusprechen. Ich hätte nicht mal gewusst, wie ich es hätte ausdrücken sollen.
In der Kirche meinte man es ja gut mit mir, und im Internet konnte ich nachlesen, dass »Migrationshintergrund« auf mich zutraf: Ich hatte schließlich einen Elternteil, der nicht in Deutschland geboren wurde. Da halfen auch nicht meine guten Manieren, mein Abitur, mein deutscher Pass mit Geburtsort Oberhausen, meine Ordination in der Evangelischen Kirche im Rheinland, Interesse an deutschem Kulturgut von Goethe über Pommes Schranke bis hin zu Helene Fischer, später dann unser Eigenheim im Spießerviertel, ein weißer Ehemann, zwei weiße Kinder (wobei man sich bei meinem Sohn noch nicht ganz einig ist), ein überproportionaler Hang zu Effektivität, fundiertes Wissen über die NS-Zeit und mein ordentlicher Ruhrpott-Dialekt.
Ich liebte als Kind Bratkartoffeln mit Rahmspinat, verbrachte meine Sommer an der holländischen Nordseeküste, hatte echte Bergleute in meiner Familie, trank Medium-Sprudelwasser aus ausgespülten Senfgläsern und schaute gern die Sendung mit der Maus, den Li-La-Launebär und später »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten«. Wo war denn da bitte mein Migrationshintergrund? Evangelische Taufe, katholischer Kindergarten, Kindergottesdienste, die sogar mein eigener Opa hielt, Vorschule, Grundschule, Montessori-Gymnasium, Konfirmation, ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit, Freiwilligendienst mit der Vereinten Evangelischen Mission in Tansania, CVJM-Kolleg, Uni, Nebenjob, WGs, ...
Wenn es »den« deutschen Lebenslauf gäbe, ich würde viele Kriterien erfüllen. Was aber zum »richtigen« Deutsch-Sein fehlt: Ich bin nicht weiß. Und weil es an Begrifflichkeiten wie »People of Color« mangelte und »nicht-weiß« so klingt, als ob mir irgendwas fehlte, wählte man »Migrationshintergrund«, um auszudrücken, was sowieso alle sahen. Obwohl wir ja häufig beteuern, dass wir eigentlich keine Hautfarbe sehen und gleichzeitig oft voller Freude feststellen, wie schön bunt unsere Gemeinschaft ist. Es ist kompliziert.
Wie lange bleibt man eigentlich »Flüchtling«?
Aber dieses Phänomen gibt es nicht nur in Bezug auf Schwarze Deutsche, sondern auch in Bezug auf Menschen mit Fluchterfahrungen – und das auch nicht erst seit 2015. Wie bereits erwähnt, ist meine eigene Oma 1945 als »Flüchtling« ins Ruhrgebiet gekommen und 2018 als »Flüchtling« von dieser Welt gegangen. Dieses Gefühl, nicht ganz dazuzugehören, hat sie nie ablegen können. Heute lebe ich mit vielen Geschwistern, die ebenfalls Fluchterfahrungen haben, in einer Gemeinde, und ich frage mich oft: Wie lange bleibt man eigentlich »Flüchtling«? Ist das ein lebenslanger Status, oder wird er im Laufe der Zeit durch andere Rollenaspekte ergänzt oder ganz abgelöst? Schreiben sich Menschen diesen Status selbst zu, oder ist er eine Fremdzuschreibung durch andere? Und ab wann sprechen wir eigentlich von einem kollektiven »Wir« trotz unterschiedlicher biografischer Erfahrungen?