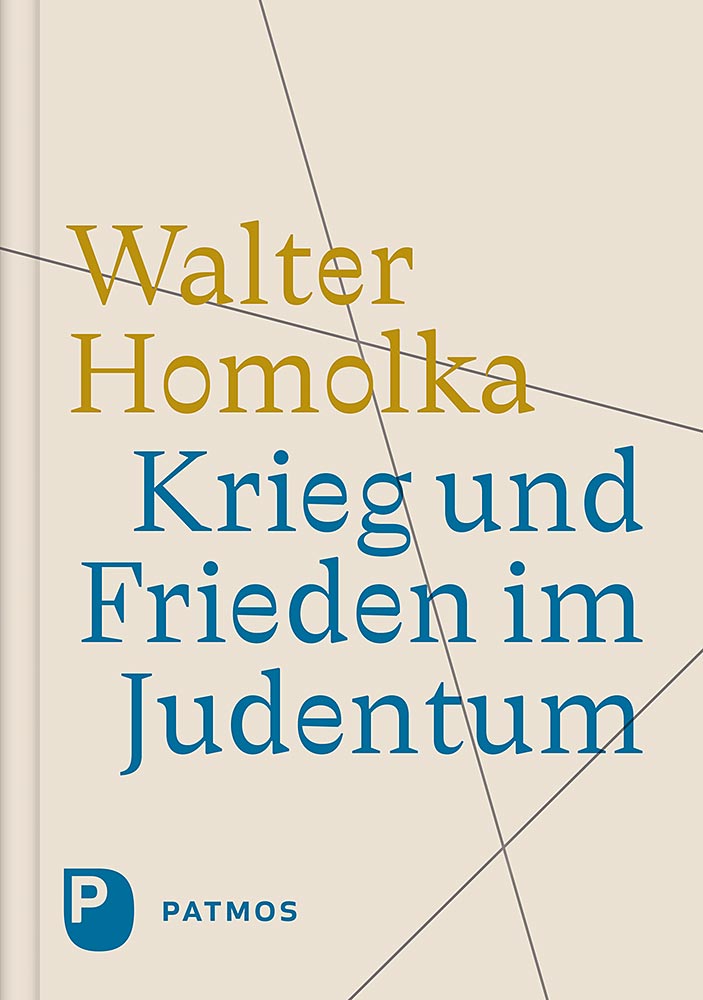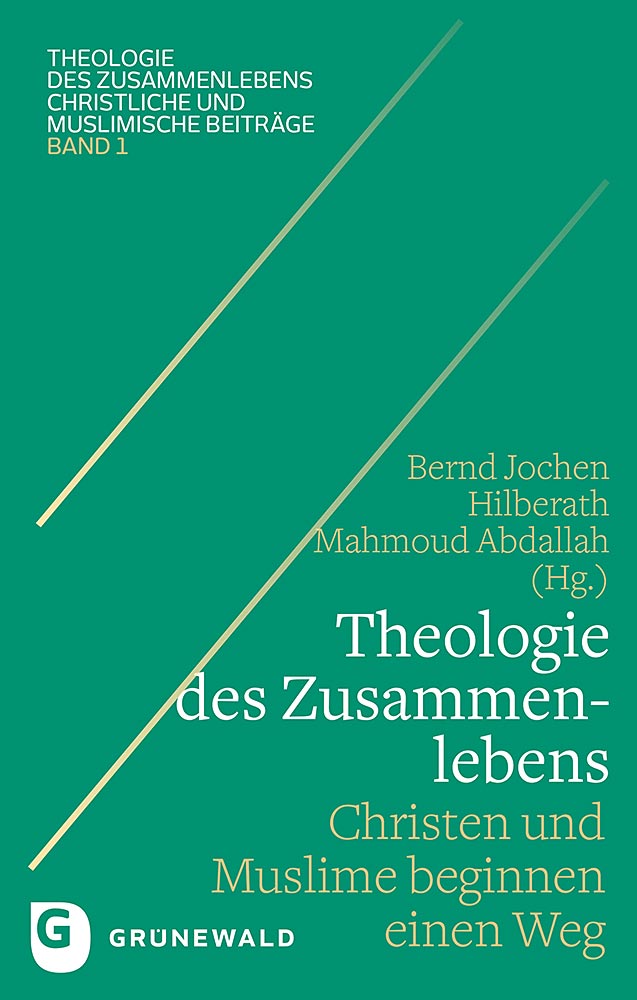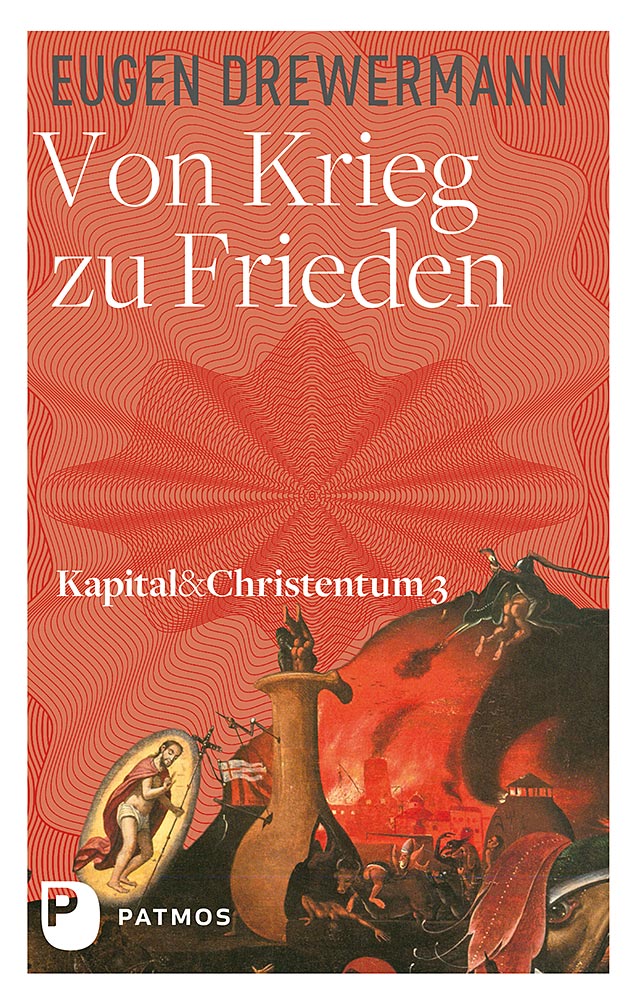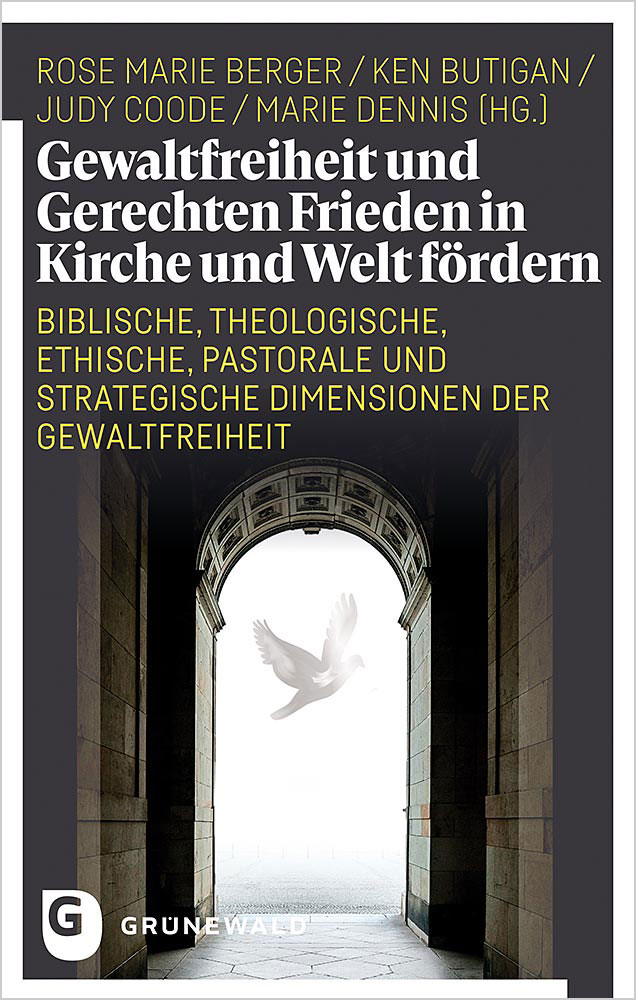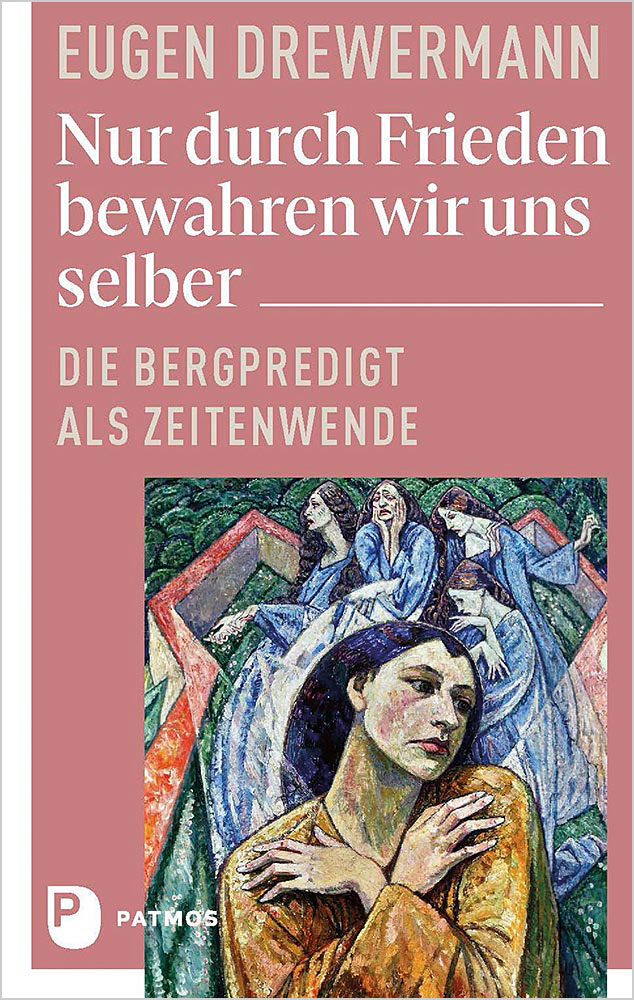Religion und Gewalt
Rabbiner Walter Homolka geht der Frage von Krieg und Frieden im Judentum nach und skizziert den Weg vom »gerechten Krieg« zum »gerechten Frieden«. Von Ulrich Sander
Reportage Gesellschaft1415 wurde Jan Hus, ein böhmischer Theologe und Vorläufer der Reformation, auf dem Konzil von Konstanz öffentlich verbrannt – in einer langen Auslegungsgeschichte eines Verses aus dem Lukasevangelium. Im Gleichnis Jesu vom Gastmahl heißt es: »Da sagte der Herr zu dem Diener: Zwinge die Leute einzutreten, damit mein Haus voll wird.« Das Wort vom »Zwang« wurde seit Augustinus (354–430) zur Rechtfertigung des kirchlichen Christentums, in Glaubenssachen Gewalt anzuwenden. Vom Propheten Mohammed ist in einer anerkannten Sammlung seiner Aussprüche aus dem 9. Jahrhundert überliefert: »Das Jüngste Gericht wird nicht kommen, bis die Muslime die Juden bekämpfen und umbringen, bis der Jude sich hinter den Steinen und Bäumen versteckt, und der Stein und der Baum werden sagen: ›O du Muslim, o du Diener Allahs, dies ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und bring ihn um.‹« Und im 5. Buch Mose heißt es als göttliche Weisung zur Eroberung des Gelobten Landes durch die aus Ägypten befreiten Stämme Israels: »Aus den Städten dieser Völker jedoch, die der Herr, dein Gott, dir als Erbbesitz gibt, darfst du nichts, was Atem hat, am Leben lassen. Vielmehr sollst du die Hetiter und Amoriter, Kanaaniter und Perisiter, Hiwiter und Jebusiter der Vernichtung weihen, so wie es der Herr, dein Gott, dir zur Pflicht gemacht hat«.
Die Kunst des Verstehens
Jede Religion steht vor der Aufgabe, eine »Kunst des Verstehens« auszubilden, in der sie selbstkritisch auf eigene Gewalttraditionen blickt und die eigene spirituelle Überlieferung als Verpflichtung zum Frieden lesen lernt. In seinem Buch »Krieg und Frieden im Judentum« stellt sich Rabbiner Walter Homolka dieser Aufgabe: von den biblischen Überlieferungen bis zur Gegenwart.
Zum zitierten Text aus dem 5. Buch Mose schreibt er: »Es geht um ein Ideal kultisch legitimierter Kriegsführung, das mit heutigen Vorstellungen von Humanität wenig gemein hat.« Die Auslegung des Bibeltextes durch die nachbiblischen Rabbinen führt – hier wie in anderen Fragen – zwar nicht zum völligen Gewaltverzicht, aber in eine grundsätzliche Begrenzung von Gewalt. Nach rabbinischer Lehre sind die im 5. Buch Mose genannten Völker längst ununterscheidbar in anderen Völkern aufgegangen, so dass der Bibeltext nicht mehr anwendbar ist.
Er lässt sich auch nicht in die Gegenwart übertragen und etwa auf Angehörige anderer Religionen beziehen. Solche rabbinischen Überlegungen waren freilich zu ihrer Zeit theoretisch, da Juden und Jüdinnen längst nicht mehr »waffenfähig« waren: Nach der Zerstörung des Tempels und der Niederlage im jüdisch-römischen Krieg war »Israel« keine politisch handlungsfähige Größe mehr, und die römischen Kriegsherren benannten die Provinz Judäa um in Syria-Palästina.
Das Friedensreich der Propheten und Philosophen
Schon zuvor war die politische Größe »Israel« jahrhundertelang aufgerieben in den Eroberungskriegen wechselnder Weltmächte. Die Verheißung des Friedens (schalom) war in den Mittelpunkt der biblischen Schriftprophetie gerückt: Der Gott Israels »spricht Recht im Streit der Völker, er weist viele Nationen zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. Ihr vom Haus Jakob, kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn« (so die Propheten Micha und Jesaja). Walter Homolka sieht das philosophisch gebildete Judentum der Zeitenwende in der Nachfolge des Friedensideals der biblischen Propheten. Der jüdische Philosoph Philo von Alexandrien (gest. 40 n. Chr.) interpretiert die »kriegerischen« Stellen der Tora des Mose sinnbildlich – als Bilder für den inneren Kampf der Seele um die Tugend. Er geht über die Propheten insofern hinaus, als er nicht mehr zwischen Nationen unterscheidet, sondern Religion als grundsätzlich an den Menschen gerichtet begreift. In dieser hellenistischen Zeit vor dem Christentum als Staatsreligion war das Judentum eine missionierende Religion, die gerade durch ihr Friedensideal Zuspruch fand. Als Beispiel führt Philo an, dass der israelitische Hohepriester seine Bitt- und Dankgebete für die gesamte Menschheit und die ganze Welt spreche – im Unterschied zu den Priestern anderer Völker.
»Die Tora besteht des Friedens wegen«
Nach der Niederlage im jüdisch-römischen Krieg gab es endgültig keinen Tempel und damit keinen Hohepriester und keine Führungsfunktion des Tempeladels mehr. Die kommende Epoche des Judentums prägen die Rabbinen und ihre »Kunst des Verstehens«, mit der sie die biblischen Texte für ihre Gegenwart erschließen. Gott habe seinem Bundesvolk die Tora als Quelle der Friedenslehre offenbart und daher sei die Tora unter der Maßgabe zu verstehen, »den Frieden in der Welt zu mehren«. Alle göttlichen Gebote seien mit dem Frieden verknüpft und die gesamte Tora des Mose bestehe »nur des Friedens wegen«. »Gott, einst Herrscher über die Kriegsdämonen, erhält den Namen ›Frieden‹, er selbst ist der Frieden, weshalb ein Verstoß gegen den Frieden einem Angriff auf Gott gleichkommt.«
In seinem Buch »Krieg und Frieden im Judentum« schreitet Walter Homolka den Weg dieser »Kunst des Verstehens«, die im Frieden den Kern der Botschaft des Judentums sieht, weiter ab: nach dem talmudischen Judentum die jüdische Mystik und Religionsphilosophie des Mittelalters und der Aufklärung, die neuzeitlichen Strömungen des Judentums bis hin zur 1978 gegründeten israelischen Friedensbewegung »Schalom achschaw« und zeitgenössischen jüdischen Denkerinnen und Denkern.
Bedrohung und Selbstverteidigung
Ein eindringliches Beispiel für militante jüdische Selbstverteidigung im 20. Jahrhundert war der Aufstand im Warschauer Ghetto im April 1943. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg und der Gründung des Staates Israels stellte sich für Jüdinnen und Juden die Frage nach einer gerechtfertigten Gewaltausübung ganz neu: angesichts der Neuerrichtung der politischen Größe »Israel« und deren konkreter Bedrohung. Walter Homolka bezieht sich darauf, dass noch vor der Staatsgründung Israels sich eine Philosophie und Theologie des Friedens unter Jüdinnen und Juden im Land entwickelt hatte. 1925 entstand die Vereinigung ›Brit Schalom‹ (»Friedensbund«), mitbegründet von Martin Buber (1878–1965), die das jüdisch-arabische Verständnis fördern sollte. Ihre Nachfolgeorganisation war ›Ichud‹ (»Einheit«), gegründet 1942 von Judah Leon Magnes (1877–1948), einem Reformrabbiner, welcher der erste Präsident der Hebräischen Universität in Jerusalem, wurde. Er proklamierte: »Eine der größten Kulturpflichten des jüdischen Volkes ist der Versuch, in das Gelobte Land zu kommen, nicht durch Eroberung wie Joschua, sondern auf friedlichen und kulturellen Wegen: durch schwere Arbeit, Opfer, Liebe und mit der Entscheidung, dass man niemals etwas tun wird, das nicht vor dem Gewissen der Welt verteidigt werden kann«.
Verstehen als Weg zum Frieden
Auch heute lassen sich rabbinische Stimmen als Mahner des Friedens hören. Der liberale Rabbiner Moshe Reuven Zemer (1932–2011) erinnert an die Antwort des großen Maimonides auf die Frage, warum nicht David (sondern erst sein Sohn Salomo) den Jerusalemer Tempel bauen durfte: wegen seiner Grausamkeit im Krieg: »Wenn dies für König David galt, um wieviel mehr gilt es für die gewählten Vertreter des Volkes und die Befehlshaber der Armee heute.« Was bleibt ist das Dilemma zwischen einer prophetisch geprägten Friedensliebe und der Notwendigkeit, die eigene Existenz zu verteidigen und sich in einem feindlichen Umfeld zu behaupten.
Walter Homolka führt in seinem Buch an vielen Beispielen vor Augen, wie wichtig eine »Kunst des Verstehens« ist. Darin ist sein Buch beispielhaft für alle Religionen: Gerade auch Religionen brauchen eine »Kunst des Verstehens«, die den Bezug auf »heilige« Texte, auf eine vermeintlich heile Vergangenheit oder eine in Aussicht gestellte herrliche Zukunft, in eine Diskussion stellt, deren Ziel Humanität und Frieden ist.
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Abonnieren Sie hier unseren Newsletter und erhalten Sie jede Woche weitere interessante Impulse, Geschichten und Rezepte.