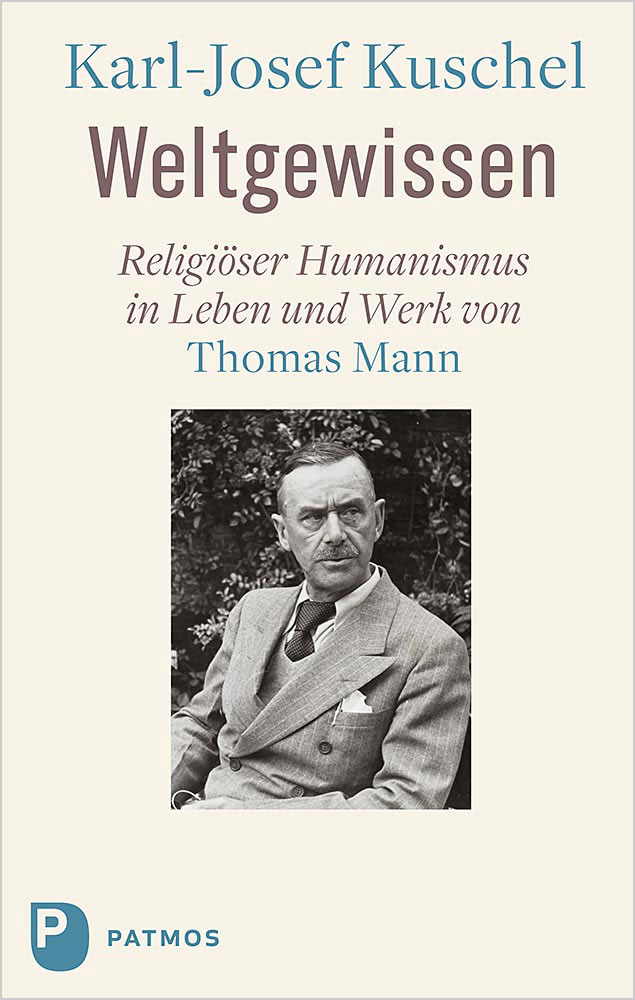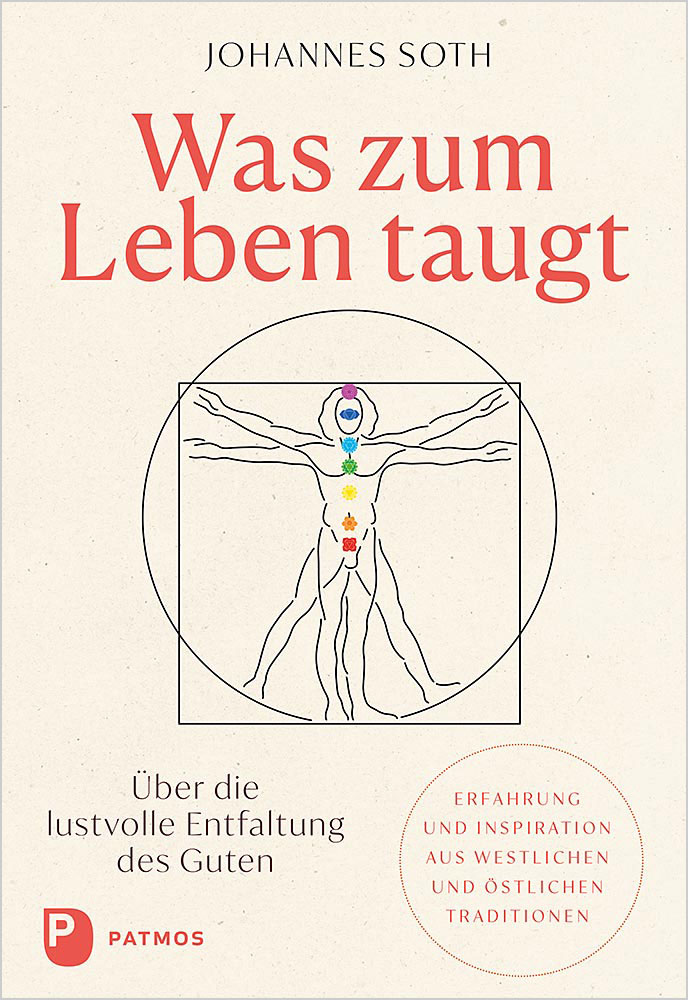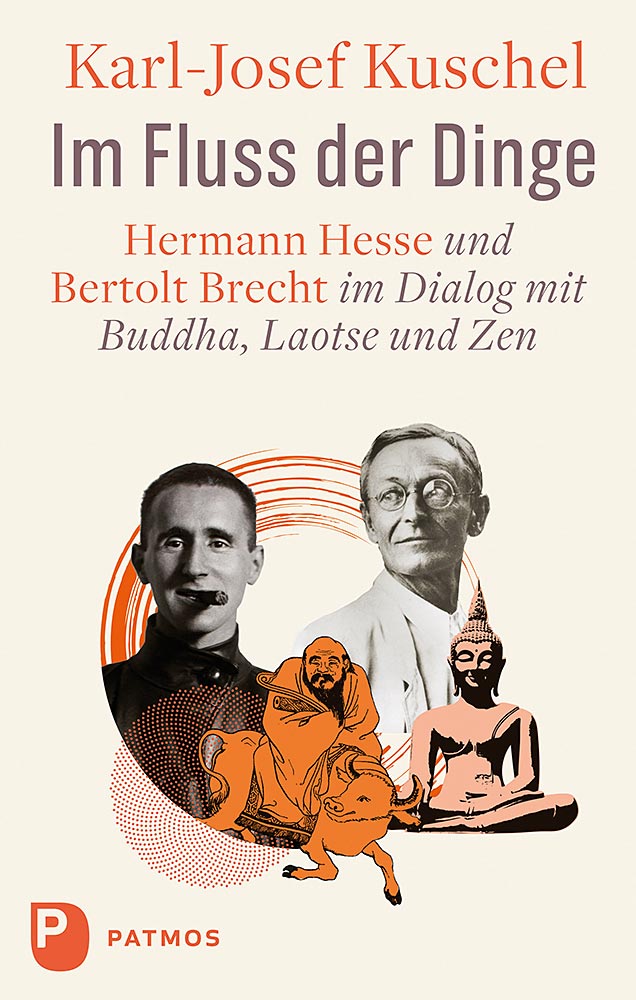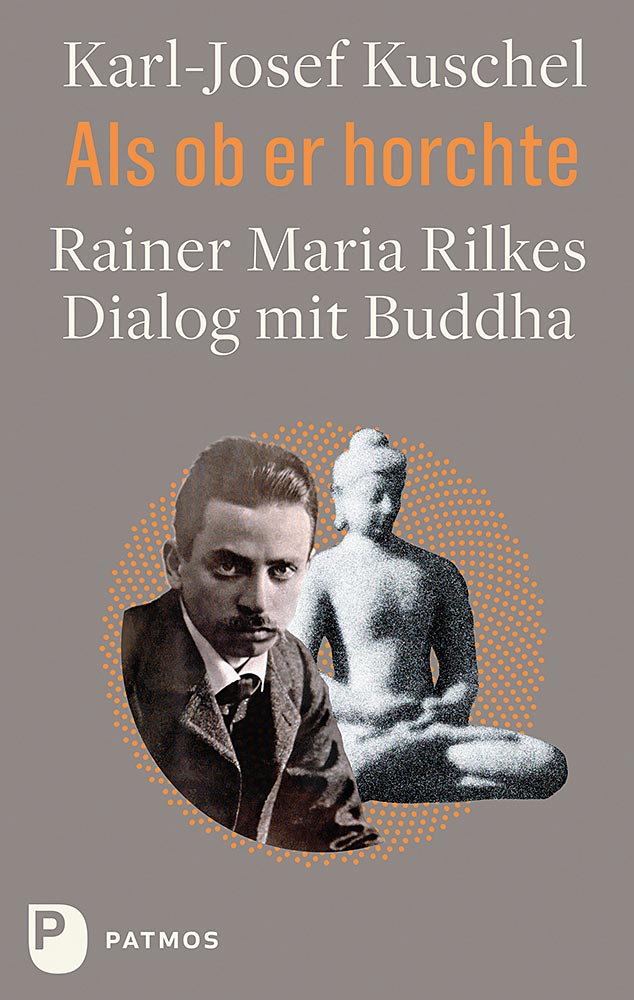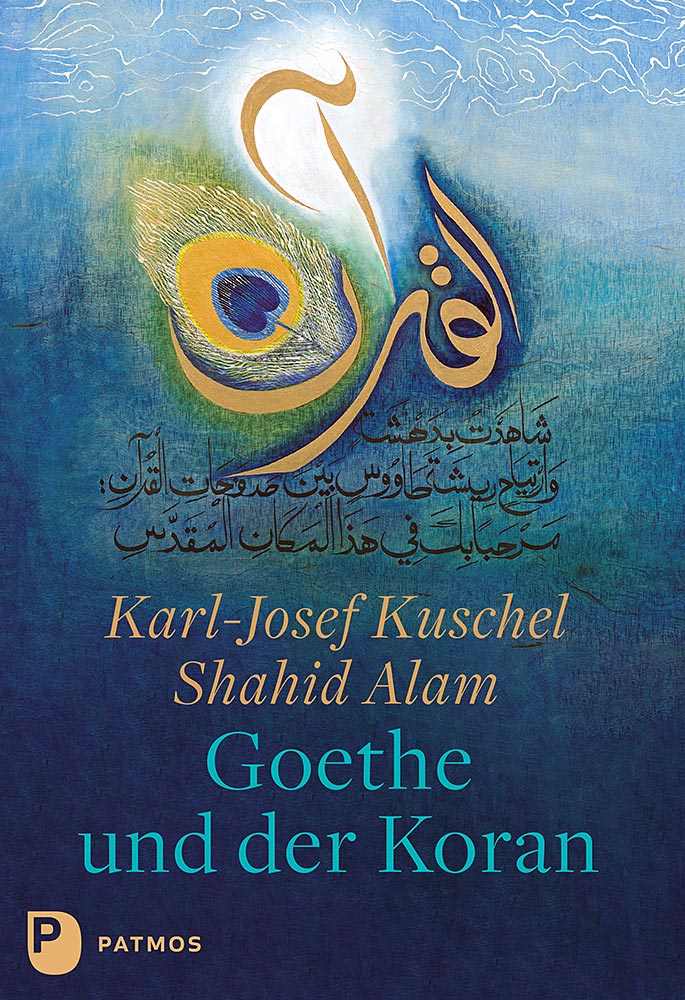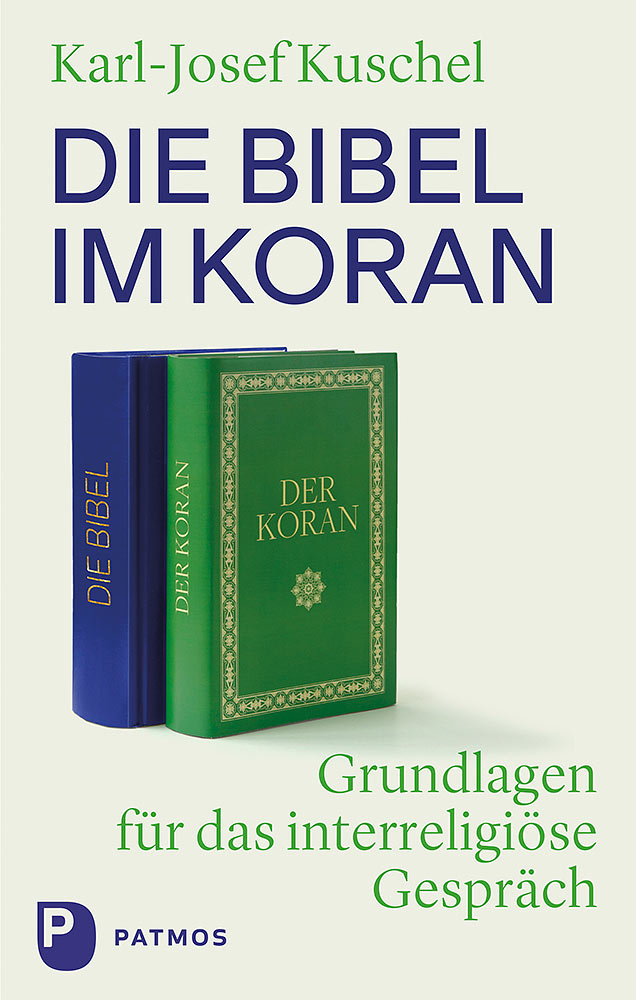Ungläubiger Thomas (Mann)?
Am 6. Juni 2025 jährt sich der Geburtstag Thomas Manns (1875–1955) zum 150. Mal. Für »Die Buddenbrooks« erhielt er 1929 den Literatur-Nobelpreis. Sein Erstlingsroman ist auch ein Abgesang auf ein verbürgerlichtes Christentum. Ein Überblick von Karl-Josef Kuschel.
Aktuelles GeburtstagWas hat Thomas Mann zu Religion zu sagen? »Glaube? Unglaube? Ich weiß kaum, was das eine ist und was das andere. Ich wüßte tatsächlich nicht zu sagen, ob ich mich für einen gläubigen Menschen halte, oder für einen ungläubigen.« Was immer er gewesen ist, ein gläubiger Zweifler oder ein zweifelnder Gläubiger, in Sachen »Religion« hat Thomas Mann in den jeweiligen Zeitenwenden seines Lebens ein eigenes, unverwechselbares Profil ausgebildet – jenseits aller schon bekannten Kategorien. In meinem Buch »Weltgewissen« habe ich diese Suchbewegungen nachgezeichnet: Was bedeutet Religion in Leben und Werk von Thomas Mann?
Thomas Mann: Ein Jahrhundertzeuge
Als Thomas Mann 1875 in Lübeck geboren wird, herrschen in England noch Queen Victoria und in Deutschland Wilhelm I., der Kaiser der Gründung des Deutschen Reiches. Es ist die Hoch-Zeit des europäischen Nationalismus, Imperialismus und Kolonialismus. Als Kaiser Wilhelm II. 1888 auf den Thron kommt, ist Thomas Mann 13 Jahre alt. Erwachsen geworden, wird er zum Zeugen dramatischer Zeitenwenden: des Ersten Weltkriegs und des Untergangs der Monarchie; der Ausrufung einer Republik und der Bekämpfung des demokratischen Staates durch totalitäre Massenbewegungen zur Linken und zur Rechten. Dann der »Machtergreifung« des völkisch-rassistischen Faschismus in Deutschland, der ungezählte Wissenschaftler, Intellektuelle und Künstler ins Exil treiben sollte, darunter Thomas Mann selbst. Zeuge schließlich der von Deutschland ausgehenden Gewalt, die sich zu einem neuen Weltkrieg und zur versuchten Vernichtung des europäischen Judentums und sogenannten »unwerten Lebens« entwickeln wird.
Was war für Thomas Mann die Konsequenz aus seinen vielen Lebens- und Werkstationen und aus den Erfahrungen mit dem abgründig Bösen in den 1930er- und 1940er-Jahren des 20. Jahrhunderts? Nicht nur, dass »die liberale Demokratie zur sozialen werden« müsse, sondern auch: dass es einen »neuen« Humanismus braucht, nicht »dünn-rational«, sondern »religiös fundiert und gestimmt. Ein Humanismus, der Humanität und Religiosität versöhnt und zu Bündnispartnern macht. »Religion ist Ehrfurcht, die Ehrfurcht vor dem Geheimnis, das der Mensch ist« (1945).
Bis zu diesem Punkt hatte Thomas Mann einen langen Weg gehen müssen, angefangen von der gnadenlosen Beschreibung des Verfalls der »bürgerlichen« Religion in seinem ersten Roman »Die Buddenbrooks« (1901). Ein Suchprozess nach dem Eigenen, Unverwechselbaren, persönlich Glaubwürdigen jenseits einer vorgegebenen Katechismus-Gläubigkeit.
Ein Sucher in der Welt der Religionen
Zu Beginn seines Werkes bis zum Ersten Weltkrieg steht »Religion« bei Thomas Mann im Zeichen der Schwäche und des Verfalls eines einstmals starken, alles dominierenden Christentums: Kirche in ihrer vom bürgerlichen Milieu absorbierten Gestalt. 1931, da ist er schon 56 Jahre halt, veröffentlicht Thomas Mann sein »Fragment über das Religiöse« und stellt dort in den Mittelpunkt von Religion die Frage des Menschen nach sich selbst angesichts seines unausweichlichen Todes. Aber neben und nach solchen Überlegungen zur Religion im Allgemeinen betritt der Dichter die ungemein vielfältige »Welt der Religionen«: von den antiken Religionen angefangen bis hin zu Judentum und Christentum. Aus der biblischen Josefsgeschichte im Buch Genesis gewinnt er ein universales Menschheitsdokument: ein über 16 Jahre und dunkle Zeiten sich erstreckendes Unternehmen, begonnen in Deutschland, fortgesetzt im Exil. Am Ende stehen vier Bände und ein literarisches Gespräch mit der Bibel, das in der Weltliteratur seinesgleichen sucht: »Joseph und seine Brüder« (1933–1943).
Gegen den Faschismus: Für einen religiösen Humanismus
Unter dem Eindruck der Nazi-Diktatur kommt es bei Thomas Mann auch zu einer selbstkritischen Neubewertung des Christlichen und dessen Wertekanons. Jetzt, ab Mitte der 1930er-Jahre, spricht Thomas Mann in seinen antifaschistischen Essays und Reden aufs Neue vom Christentum, aber nicht mehr von dessen schwach gewordener, verbürgerlichter Gestalt. Jetzt kämpft er für das jüdisch-christliche Ethos als Widerstands- und Orientierungskraft gegen die Verrohung des Sittlichen durch Faschismus, Rassismus und Militarismus.
Die Erfahrungen des oft genug theologisch verharmlosten oder bürgerlich verdrängten Bösen spiegeln sich auch in seinem literarischen Schaffen. Der Komplex des Teuflischen und Höllischen wird zum Zentrum seines Romans »Doktor Faustus« (1947), ein Deutschland-Roman im Wissen, dass das eigene Land unter der Nazi-Ideologie »seine Seele dem Teufel verkauft«. Auch wenn das Verhältnis Thomas Manns zu Juden viele, auch widersprüchliche Aspekte hat, lässt er in seiner Novelle über Mose, »Das Gesetz« (1943), keinen Zweifel daran, dass aus der jüdischen Religion die »Grundgebote der Menschlichkeit« hervorgegangen sind.
In der Rückschau: Schuld und Gnade
Während seiner letzten Lebensjahre und in seinem Spätwerk tritt neben das »Gesetz« ein zweites religiöses Grundwort: die »Gnade«. »Gnade«, wird Thomas Mann öffentlich erklären, spiele nicht umsonst in seine späteren dichterischen Versuche hinein. Und auch persönlich kann er erklären: »Ich kenne die Gnade.« Wenn es christlich sei, das eigene Leben in seiner Schuld zu empfinden, als etwas, das der »Rettung und Rechtfertigung« bedürfe, dann sei er »kein unchristlicher Schriftsteller«, denn sein ganzes Lebenswerk sei »diesem bangen Bedürfnis nach Gutmachung, Reinigung und Rechtfertigung entsprungen«. Thomas Mann schreibt mit dem »Erwählten« (1951) die Parabelgeschichte von einem Sünder, der, tief gefallen, zu Reue und Buße fähig ist und so Vergebung erlangen kann. Etwas also, das Thomas Mann im deutschen Volk nach 1945 vermisst: die Bereitschaft zu Reue und Buße, aus der nach der ungeheuren Schuld ein Neuanfang glaubwürdig wäre.
Der Jahrhundertzeuge Thomas Mann: In meinem Buch »Weltgewissen« gehe ich den großen Wandlungen in seinem Leben und in seinen Werken Phase für Phase nach. Seine Wandlungen sind exemplarisch für das Schicksal von »Religion« im Kontext Europas und seiner Kultur- und Religionsgeschichte. Zunächst: Was der Dichter als »Schwund-« und »Verfallsstufe« des Christlich-Kirchlichen beispielhaft zu demonstrieren wusste, ist heute hierzulande ein Massenphänomen. Eine aktuelle Zeitansage ist aber auch sein Ruf nach einem religiös fundierten Humanismus, zu dem alle Religionen beitragen könnten und müssten. Es geht um eine Haltung, in welcher der Mensch sich »in ehrender Andacht vor dem Geheimnis verneigt, das am Grunde aller menschlichen Existenz liegt und das niemals aufgehoben werden darf, weil es heilig ist« (Kanzelrede 1951).
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Abonnieren Sie hier unseren Newsletter und erhalten Sie jede Woche weitere interessante Impulse, Geschichten und Rezepte.