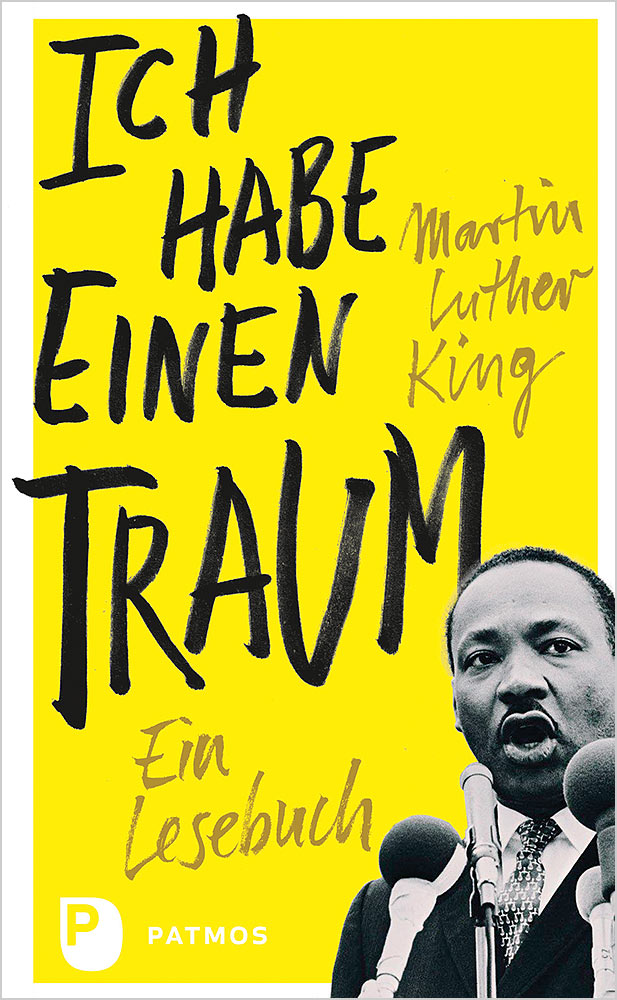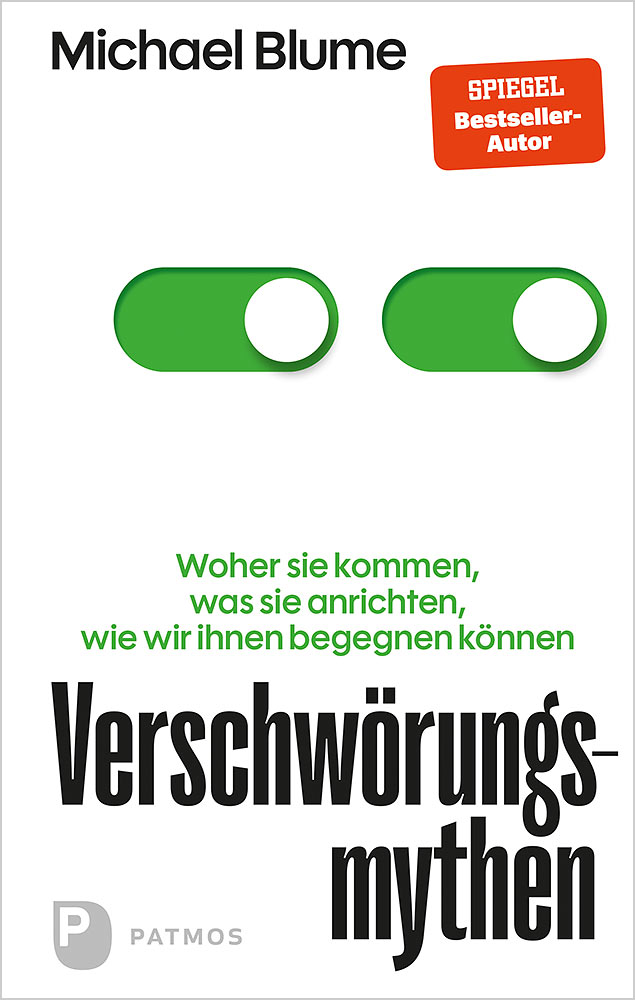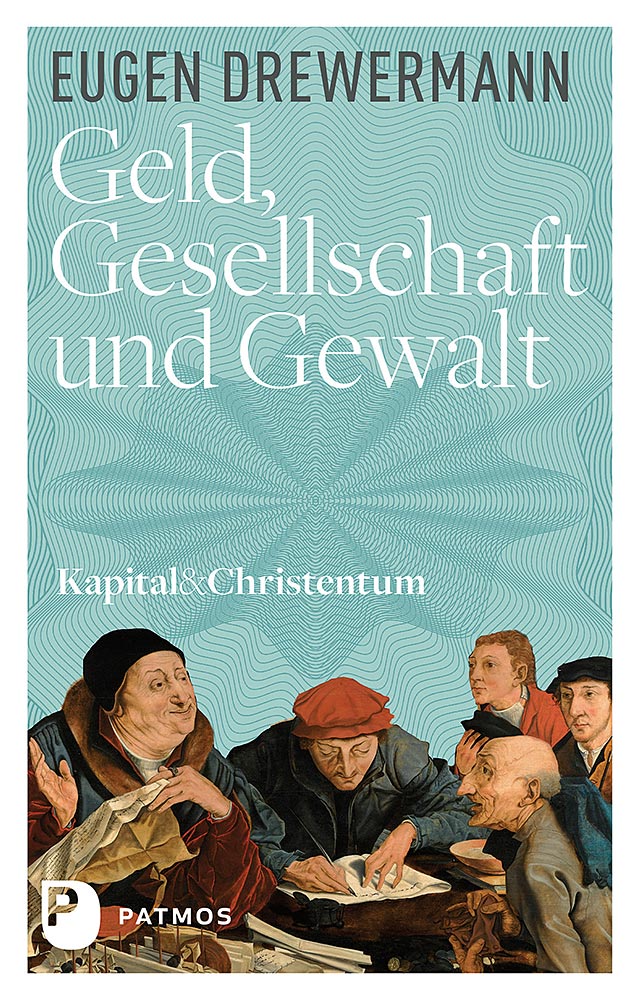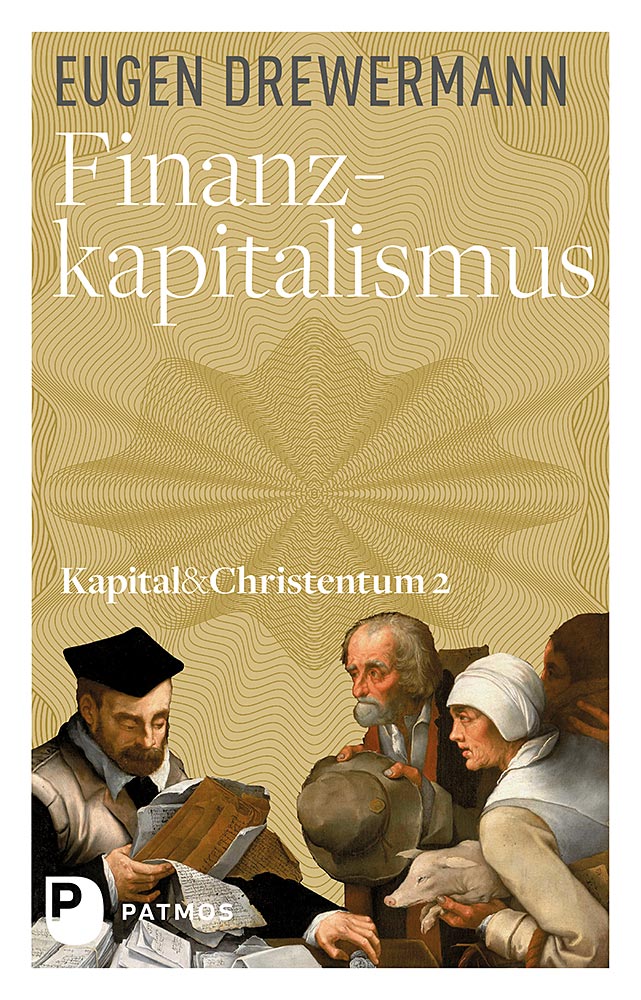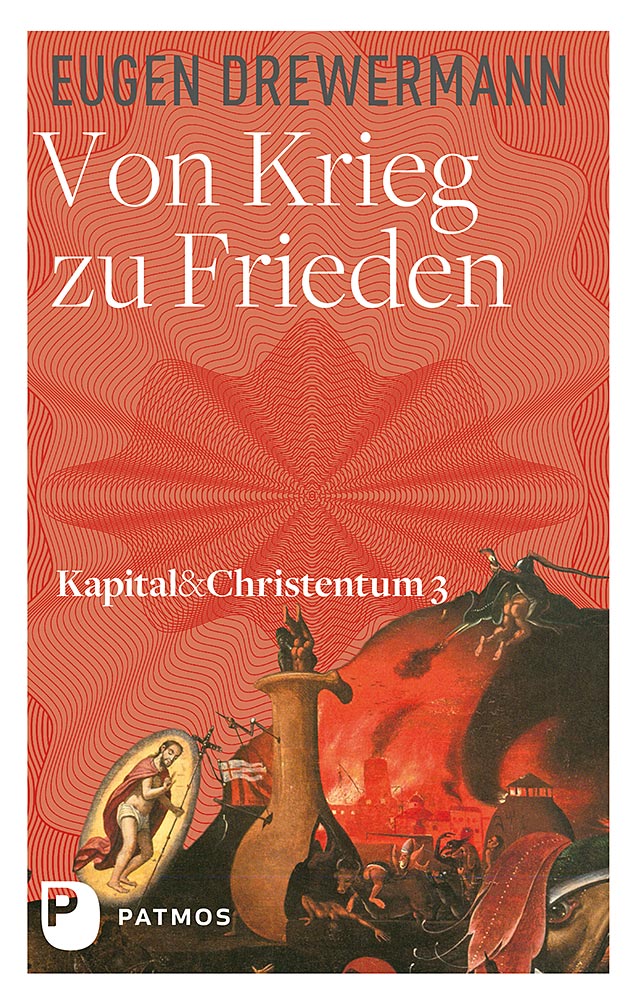Donald Trumps zweiter Wahlsieg im Spiegel der Religion
Auch Trumps zweiter Wahlsieg ist schwer zu erklären, ohne die Bedeutung von Religion in der US-amerikanischen Politik zu verstehen
Aktuelles Reportage GesellschaftEin Blick zurück: Der knappe Wahlsieg Donald Trumps im Jahr 2016 hat die Geschichte verändert, sein fulminanter Triumph im Jahr 2024 hat die meisten Menschen außerhalb der USA verstört. Wer dachte, die Abwahl des umstrittenen US-Präsidenten nach dessen erster Amtszeit hätte das Phänomen des »Trumpismus« beendet, wurde eines Besseren belehrt. Bereits 2019 wurde vom Salzburger Religionswissenschaftler Andreas G. Weiß eine Analyse vorgelegt: »Trump – Du sollst keine anderen Götter neben mir haben«. Der Autor ist Mitglied der »American Academy of Religion«. Er beleuchtet die Bedingungen und Ursachen für Trumps Erfolg aus religionspolitischer, biographischer und historischer Sicht.
Das alles ließ den Wunsch nach einem »starken Retter«, einer messianischen Gestalt, in den letzten Jahren nicht verschwinden, sondern durch die vielfachen internationalen Krisenerfahrungen immer wieder anwachsen. Donald Trump bedient genau diese Stimmungslage. Seine Versprechen eines »Goldenen Zeitalters« für die USA und seine radikalen Lösungskonzepte treffen den Nerv einer zerrütteten Gesellschaft. Dass er dabei die demokratische Grundfeste der Vereinigten Staaten von Amerika und ihr System der Gewaltenteilung gefährdet, scheint den politischen Quereinsteiger Trump nur wenig zu kümmern. Er stellt genau jene Strukturen infrage, die ihn selbst an die Macht gebracht haben.
Andreas G. Weiß wirft einen Blick auf das religiöse Selbstverständnis des US-amerikanischen Patriotismus, auf die amerikanische »Zivilreligion«. Zu ihr gehört die Überzeugung, dass sich das Land infolge göttlicher Erwählung auf einer heiligen Mission befindet: »One Nation under God«. Teil davon ist auch die zivilreligiöse Rolle des Präsidenten, der, wie ein biblischer Patriarch, den braven, gläubigen, moralisch einwandfreien Anführer und »Familienvater« der Nation darstellt (dem Trump in seiner persönlichen Lebensführung wenig entspricht …). Andreas Weiß führt die religionspolitische Wende in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor Augen, in der das freikirchliche evangelikale Milieu in den USA sich politisiert und die Republikanische Partei sich mit den Evangelikalen verbündet – und mit ihren stark auf die US-amerikanische Nation bezogenen Vorstellungen eines »bibeltreuen Christentums«. Zum Anlass der zweiten Amtszeit von Donald Trump erschien eine Sonderausgabe der Bibel mit wehender US-Flagge und dem Untertitel »God bless the USA« mit den eingeprägten Daten der Amtseinführung.
Katholische Kirche in den USA
Aufgrund ihres »Zentrums« Rom und ihrer ethnischen Zusammensetzung (Iren, Italiener, Hispanics) schienen Katholikinnen und Katholiken bis ins 20. Jahrhundert hinein wenig in den Gründungsmythos der amerikanischen Zivilreligion integrierbar. Mittlerweile hat die politische Rechte aber längst erkannt, dass sie die aktuell rund 52 Millionen erwachsenen und damit wahlberechtigten Mitglieder der inzwischen zweitgrößten Religionsgruppe des Landes nicht aus ihrer Strategie ausklammern kann. Und umgekehrt haben es die kirchlichen Oberen der US-amerikanischen Bistümer sichtlich genossen, von Vertretern der öffentlichen Politik umworben zu werden. Lange Zeit haben sich katholische Verantwortungsträger gerne im Fahrwasser des konservativen Kurses der Republikanischen Partei treiben lassen. Heute ist die katholische Kirche in den USA selbst äußerst polarisiert. Ihre Mitglieder sind sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern zu finden. Die Wahl 2024 zeigte, dass die Schnittmenge zwischen republikanischer Parteitaktik und dem Moralverständnis konservativer Katholiken (Abtreibung, Homosexualität, Gender-Debatte) ein nicht zu unterschätzendes Reservoir an Wählerstimmen darstellt, das zum entscheidenden Zünglein an der Wahlwaage werden kann. Trumps radikaler Anti-Migrationskurs hat sich dagegen nicht entsprechend ausgewirkt: immerhin bezog die römisch-katholische Kirche doch einen Gutteil ihrer Gläubigen aus den jahrzehntelangen Einwanderungsbewegungen aus Mittel- und Südamerika.
Wankende Gewissheiten
»One Nation under God«: Das lange hochgehaltene Erwählungsbewusstsein der USA ist zerbrechlich: Die vormals unhinterfragte Supermacht hat viel von ihrem einstmaligen Selbstbewusstsein verloren. Genau in diese Kerbe schlägt Donald Trump – und bringt damit das innen- und außenpolitische System der USA gehörig ins Wanken. Innenpolitisch: Seit ihrer Gründung war die politische Realität der Vereinigten Staaten auf Gewaltenteilung und ein ausgewogenes Spiel der politischen Kräfte angewiesen. Die vergangenen Jahre, die letzten Urnengänge und Wahlkämpfe haben dagegen deutlich gemacht, dass ein Zusammenspiel von Demokraten und Republikanern nur mehr schwer möglich scheint. Außenpolitisch: Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs standen internationale Bündnisse und Absprachen im Zentrum der Außenpolitik. Trumps erneuter Wahlsieg verdankt sich einer explosiven Stimmungslage – nämlich der früher nur schwer vorstellbaren Angst, dass ausgerechnet einstmals hochgelobte Faktoren wie Einwanderung, Globalisierung, freier internationaler Markt, militärische Bündnisse oder Beistandsverpflichtungen die amerikanische Gesellschaft destabilisieren und an den Abgrund bringen würden. Die »Stadt auf dem Berge« (Ronald Reagan 1989) wirkt, als möchte sie ihre Stadtmauern höherziehen und alle Eingänge verbarrikadieren. Dies hat Auswirkungen, die nicht zuletzt auch auf andere Kontinente übergreifen könnten.
Kein Wunder, dass populistische Regierungen und Parteien weltweit den neuerlichen Wahlerfolg Trumps bejubeln, sehen sie darin doch auch ihre eigene Taktik bestätigt. Zugleich wird deutlich, dass auch in Europa und anderen Erdteilen christlich-soziale Parteien vor der Gretchenfrage ihrer eigenen Identität stehen – angesichts von Säkularisierung, Entkirchlichung, Abnahme traditioneller Wertbindungen. Während einige Gruppierungen sich in dieser Situation einem ständig wachsenden rechten Extremismus anbiedern, ringen andere konservative Kräfte um die Glaubwürdigkeit ihrer eigenen Bewegung, um nicht vollends in rechtsnationale Tendenzen abzugleiten.
Andreas G. Weiß' Buch über Donald Trump wirkt auch 2025 noch nach, wesentliche Befürchtungen seiner Analyse 2019 haben sich bewahrheitet. Zugleich kann das Verstehen aber helfen, mit dem Phänomen Trump auch während dessen zweiter Amtszeit umgehen zu lernen.
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Abonnieren Sie hier unseren Newsletter und erhalten Sie jede Woche weitere interessante Impulse, Geschichten und Rezepte.